Aktuelles
Facebook-Revolutionen? - Die Überhöhung elektronischer Medien (Beitrag für HUMBOLDT / zeitschrift des goethe-instituts Nr. 157: Protest 2.0)
 Es ist ein Gemeinplatz: Elektronische Medien und soziale Netzwerke verändern Politik und soziale Bewegungen. Twittern ist zur verbreiteten Kommunikationsform geworden, mit den „Piraten“ sind in mehreren europäischen Ländern Parteien entstanden, die die neuen Möglichkeiten elektronischer Kommunikation zum gesellschaftliches Programm erweitern wollen, und die Aufstände des „arabischen Frühlings“ werden gar als „Facebook-Revolutionen“ bezeichnet.
Es ist ein Gemeinplatz: Elektronische Medien und soziale Netzwerke verändern Politik und soziale Bewegungen. Twittern ist zur verbreiteten Kommunikationsform geworden, mit den „Piraten“ sind in mehreren europäischen Ländern Parteien entstanden, die die neuen Möglichkeiten elektronischer Kommunikation zum gesellschaftliches Programm erweitern wollen, und die Aufstände des „arabischen Frühlings“ werden gar als „Facebook-Revolutionen“ bezeichnet.
Doch es gibt gute Gründe, der allgemeinen Euphorie zu widersprechen.
(Fast-) Liebeserklärung an die Linkspartei

Ich bin in dieser Woche der LINKEN beigetreten. Um diese Entscheidung zu begründen, muss ich zunächst mal erklären, warum mich Parteien in 30 Jahren politischen Aktivismus‘ bislang wenig interessiert haben.
Als politisch denkender Mensch lernt man schnell, dass die Zusammensetzung von Regierungen und Parlamenten für politische Entscheidungsprozesse in einer Gesellschaft oft völlig bedeutungslos ist. Der keynesianische Wohlfahrtsstaat wurde von Konservativen in Frankreich ganz ähnlich „gestaltet“ wie von deutschen Sozialdemokraten.
"Poetik des Terrors?" - Interview mit dem Literaturwissenschaftler Michael König über den Roman "Der bewaffnete Freund"
 Lässt sich politische Gewalt literarisch diskutieren, ohne in Apologie zu verfallen? Wird Terrorismus dadurch zum plot trigger? Auf welcher Materialgrundlage schreibt man eigentlich?
Lässt sich politische Gewalt literarisch diskutieren, ohne in Apologie zu verfallen? Wird Terrorismus dadurch zum plot trigger? Auf welcher Materialgrundlage schreibt man eigentlich?
Als "Der bewaffnete Freund", ein Roman über den bewaffneten Konflikt im Baskenland, 2007 erschien, diskutierten RezensentInnen kontrovers über das Buch.
Jetzt haben der Münsteraner Literaturwissenschaftler Michael König und Raul Zelik im Rahmen des Forschungsprojektes "Poetik des Terrors" neu über den Roman diskutiert.
Richtiger Roman mit falscher Story? Dietmar Daths / Barbara Kirchners „Der Implex“ (WOZ 22.3.2012 / ak April 2012)
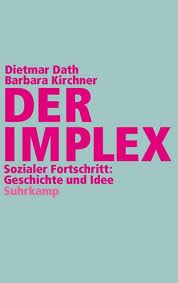
Keine vier Wochen ist es her, dass Barbara Kirchners und Dietmar Daths „Roman in Begriffen“, immerhin 880 Seiten dick, erschienen ist und schon haben ein Dutzend deutschsprachiger Feuilletons das Buch vorgestellt. Das ist insofern einigermaßen überraschend, als es sich um eine glühende Verteidigungsschrift des Kommunismus, richtiger: der Traditionslinie Marx-Engels-Lenin handelt. Kein Manifest im eigentlichen Sinne, aber für philosophische Prosa doch recht agitatorisch.
Dass ein derartiges Buch wahrgenommen wird, hat natürlich nicht nur mit der Krise, sondern auch mit den AutorInnen zu tun. Kirchner ist Professorin für theoretische Chemie und schreibt Science-Fiction-Romane, Dath war Wissenschaftsredakteur der FAZ, leitete das Musikmagazin Spex und gilt als einer der originellsten deutschsprachigen Schriftsteller. Wenn diese beiden sich zum Ziel setzen, den – in den Verhältnissen implizierten (daher „Implex“) – Möglichkeiten der Veränderung nachzuspüren, kann man also Vielschichtiges erwarten.
TAZ im Glück. Besser als die LeserInnen? (WOZ 26.4.2012)
 Der Berliner tageszeitung geht es gut. Ihr Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch erklärte unlängst, die Zeitung erwirtschafte jährlich 300.000 Euro Überschuss und habe mittlerweile 11 Millionen Euro Rücklagen angehäuft. Ein einigermaßen überraschendes Ergebnis, wenn man weiß, wie viele Printmedien heute ums Überleben kämpfen und dass es konzernunabhängige Zeitungen dabei besonders schwer haben.
Der Berliner tageszeitung geht es gut. Ihr Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch erklärte unlängst, die Zeitung erwirtschafte jährlich 300.000 Euro Überschuss und habe mittlerweile 11 Millionen Euro Rücklagen angehäuft. Ein einigermaßen überraschendes Ergebnis, wenn man weiß, wie viele Printmedien heute ums Überleben kämpfen und dass es konzernunabhängige Zeitungen dabei besonders schwer haben.
Bei der Lektüre der TAZ stellt sich darüber hinaus jedoch noch eine andere, möglicherweise damit verbundene Frage: Warum macht eine Redaktion, in der so viele Linke arbeiten, eigentlich eine so unkritische Zeitung?
"Paramilitaries": a short scientific definition (Online Dictionary "Interamerican Wiki", University of Bielefeld)

Translation by Andy Jones.
The dictionary of the Real Academia Española (2006) defines paramilitaries as belonging to a civil organization with military organization . This general definition, however, hardly contributes to a differentiation, as by its logic guerrilla organizations would have to be described as paramilitaries. In debates in Political Science, only organizations which either openly or covertly operate on the side of the state authorities are thus considered as paramilitaries. This also makes sense etymologically: the Greek prefix para points to regional or temporal closeness, but also closeness in terms of content. Para-militaries would accordingly be structures affiliated with the army.
La Guerra asimétrica. Una lectura crítica de la transformación de las doctrinas militares occidentales (Revista Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, abril 2012)

En los últimos años, las doctrinas militares occidentales han sido sometidas a un proceso de transformación profunda. La Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) habla hoy, a la luz de los atentados islamistas y los ataques de piratas en la zona del Cuerno de África, de “nuevos desafíos asimétricos”. En medios universitarios y foros políticos, el concepto de las “nuevas guerras” del hemisferio sur se ha convertido en una figura discursiva fija. Y todos discursos, se basan en la suposición que la “civilización occidental” está amenazada por el caos y, por consiguiente, se enfrenta a formas completamente nuevas de confrontación militar.
Este trabajo busca analizar críticamente estos discursos sobre políticas de seguridad; comienza bosquejando los antecedentes del concepto de “guerra asimétrica” que ronda los actuales debates públicos.
Surveying Utopia. A Conversation about the Myths of Capitalism and the Coming Society

By Raul Zelik and Elmar Altvater
[The following chapter on economics published in: Surveying Utopia (“Vermessung der Utopie,” 2010) is translated from the German on the Internet.]
Raul Zelik, b.1968, works in the border area of literature, social sciences and political activism. Zelik was a guest professor for politics at the National University in Bogota. Elmar Altvater, b.1938, is an emeritus professor for political economy at the Free University of Berlin. His books on globalization have been bestsellers. Altvater is a member of the academic advisory council of Attac Germany.
Denunziert. Raul Zelik über seine Überwachung durch den Verfassungsschutz (WOZ / Freitag 2. Februar 2012)

Vor einigen Tagen flatterte Post des Verfassungsschutzes bei mir ins Haus. Als eher naives Gemüt dachte ich einen Moment, der Geheimdienst wolle sich für seine Untätigkeit gegenüber dem „nationalsozialistischen Untergrund“ rechtfertigen oder rufe gar zu einer Kampagne gegen den militanten Rechtsextremismus auf. Doch weit gefehlt: Man teilte mir mit, ich sei in den vergangenen Jahren wegen mutmaßlicher Verbindungen zur baskischen Separatistenorganisation ETA überwacht worden.
Libro "¿Otros Mundos Posibles? Crisis, gobiernos progresistas, alternativas de sociedad" (Creative Commons-Download)
 En mayo 2011, activistas e investigadores de siete países se reunieron en Medellín, invitados por la Fundación Rosa Luxemburg y la Universidad Nacional de Colombia, para debatir sobre la crisis global y posibles estrategias de transformación. "¿Otros mundos posibles?" resume los aportes más interesantes de esta discusión (en español).
En mayo 2011, activistas e investigadores de siete países se reunieron en Medellín, invitados por la Fundación Rosa Luxemburg y la Universidad Nacional de Colombia, para debatir sobre la crisis global y posibles estrategias de transformación. "¿Otros mundos posibles?" resume los aportes más interesantes de esta discusión (en español).
Im Mai 2011 trafen sich SozialwissenschaftlerInnen und AktivistInnen aus sieben Ländern auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Nationaluniversität Kolumbiens in Medellín, um über die globale Krise y Transformationsstrategien zu debatieren. "Otros mundos posibles" versammelt die wichtigsten Beiträge der Diskussion (auf Spanisch).
Aus aktuellem Anlass: Rechtsextremismus und Geheimdienste. Interview mit dem Historiker Daniele Ganser (Freitag Mai 2008)

Die deutsche Öffentlichkeit diskutiert über Ermittlungspannen des Verfassungsschutzes bei der Verfolgung des "Nationalsozialistischen Untergrunds", und wieder einmal sind Kompetenzerweiterungen für Polizei und Geheimdienste im Gespräche. Doch über strukturelle Probleme wird kaum geredet - darüber zum Beispiel, dass die westlichen Geheimdienste im Kalten Krieg systematisch Beziehungen ins rechtsextremistische Lager unterhielten.
So wies der Schweizer Historiker Daniele Ganser, der an der Universität Basel Internationale Zeitgeschichte lehrt, 2005 in einer Studie nach, dass die Alliierten in allen westeuropäischen Staaten – darunter auch der neutralen Schweiz – militärische Parallelstrukturen unterhielten, die mit Rechtsextremisten durchsetzt und teilweise tief in terroristische Aktivitäten verstrickt waren.
Joachim Hirsch: "Die richtigen Fragen" - Rezension von "Nach dem Kapitalismus" (Januar 2012)
Der emeritierte Professor für Politik Joachim Hirsch (Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt) schreibt im Online-Magazin Linksnet über Nach dem Kapitalismus: "Aus der einschlägigen Literatur ragt Zeliks Buch dadurch heraus, dass hier der Vesuch unternommen wird, der Komplexität und Widersprüchlichkeit der Verhältnisse gerecht zu werden."
Nach dem Kapitalismus. Perspektiven der Emanzipation oder: Das Projekt Communismus anders denken
Essay | ISBN : 978-3-89965-449-3 | 144 Seiten | Mai 2011 | 12.80 € | lieferbar | VSA: Verlag
Dass die Krise der vergangenen Jahre nicht allein mit der Finanzwelt zu tun hat, ist zumindest in der Linken ein Gemeinplatz. Nicht nur der neoliberale Finanzkapitalismus, sondern auch die Politikform "bürgerliche Demokratie", die herrschenden Entwicklungs- und Konsummuster und das auf Erdöl beruhende Energiemodell stehen heute in Frage. Linke Kritik kann diese Systemkrise zwar beschreiben, liefert aber bislang wenig Vorschläge, wie sich ein emanzipatorisches Gegenprojekt entwickeln könnte.
"Armenviertel in Caracas: Zukunft in Selbstverwaltung" (Reportage für TAZ / WOZ Ende 2011)
Caracas, unweit der U-Bahnstation California. Hier im Osten der venezolanischen Hauptstadt treffen Miami und Lagos, Apartmentsiedlungen und Armenviertel aufeinander. Oberhalb der der vom Verkehrkollaps gebeutelten Avenida Francisco de Miranda stehen verschachtelte Ziegelbauten, unterhalb mit Elektrozäunen gesicherte Apartmenthochhäuser. Dazwischen liegt eine unscheinbare, drei Hektar große Brachfläche. Zwischen Schilfgestrüpp und einigen Bäumen steht ein altes Haus, das früher einmal als Wirtschaftsgebäude einer Finca gedient haben muss. Schon vor Jahrzehnten ist die Stadt am Gelände vorbei gewachsen. Über dem baufälligen Dach weht eine rote Fahne.
Moderate Töne aus Kolumbien. Ein Jahr Regierungswechsel Uribe-Santos (Welttrends Ende 2011)

In den Medien wird die jüngere Entwicklung Kolumbiens gemeinhin als Erfolgsgeschichte gelesen. Während der Präsidentschaft von Álvaro Uribe (2002-2010) habe sich die Sicherheitslage spürbar verbessert, heißt es, das Land sei für ausländische Investitionen attraktiver geworden und dementsprechend auch die Wirtschaft gewachsen. Richtig an dieser Erzählung ist, dass sich Kolumbien bei ausländischen Investoren heute wieder größter Beliebtheit erfreut.
"Neue Bewegungen, alte Fragen" (Essay zur Occupy-Bewegung, WOZ Ende 2011)
Journalisten und Akademiker haben den neueren Protestbewegungen wie der spanischen 15M oder der US-amerikanischen Occupy-Bewegung in den vergangenen Monaten immer wieder vorgeworfen, sie agiere naiv und unpolitisch. Auch wenn der Spott fehl am Platz ist, weil die meisten Medien auf eine politischere Haltung der Protestierenden noch ablehnender reagieren würden, ist der Einwand nicht ganz von der Hand zu weisen: Das theoretische Wissen früherer Bewegungen scheint verschüttet zu sein – was die Entwicklung von Alternativen erschwert.
Jähzorn. Eltern ABC (Missy 1/2011)
 Meine Tochter fängt zu schreien an, und frage ich mich, was das bedeutet. Bei Deleuze / Guattari heißt es ja, dass so etwas gar nichts bedeutet, weil etwas ist, was es ist. – Wenn ich D&G richtig verstanden habe.
Meine Tochter fängt zu schreien an, und frage ich mich, was das bedeutet. Bei Deleuze / Guattari heißt es ja, dass so etwas gar nichts bedeutet, weil etwas ist, was es ist. – Wenn ich D&G richtig verstanden habe.
Meine Tochter schreit weiter, und ich denke, dass meine Freundin das auch sagt: dass ein Gefühl ist, was es ist. Sie behauptet außerdem, dass man keine 500 Seiten braucht, um darauf zu kommen. Jähzorn hat sie neulich gesagt, seien ungefilterte Gefühle, aber ungefilterte Gefühle von was, habe ich mich gefragt.
Die Rückkehr der Klassenkämpfe (Essay Freitag / WOZ August 2011)

Es scheint, als würde das in den Globalisierungsdiskursen der 1990er Jahre so häufig beschworene „globale Dorf“ doch noch Wirklichkeit werden. Die Fernsehberichte aus Griechenland, Italien, Ägypten oder Chile sahen sich in den vergangenen Monaten zum Verwechseln ähnlich: aufgebrachte Jugendliche liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei, die Staatsmacht geht mit enthemmter Gewalt gegen eine bislang als unpolitisch geltende Generation vor.
Aufbruch der Vielen. Die Krise der Repräsentation als Beginn der Politik. Die Bewegung "Reale Demokratie Jetzt" in Spanien (Kommentar TAZ 6.6.2011)
Die Ereignisse von Madrid und Barcelona hören nicht auf zu überraschen. Ausgerechnet jene spanische Gesellschaft, die nach der Transición, der zwischen Frankisten, Könighaus und Linksparteien ausgehandelten Modernisierung Ende der 1970er Jahre, eine so rasante Entpolitisierung erlebte, bringt heute neue Formen politischer Bewegung hervor.
"Como una catarsis colectiva". El teórico César Rendueles sobre el 15M
Domenical del periódico GARA // Sonntagsbeilage der Tageszeitung GARA (Junio 2011).
Entrevista con el teórico y activista madrileño César Rendueles sobre el movimiento 15M / Democracia Real Ya.
Interview mit dem Madrider Theoretiker und Aktivisten César Rendueles über die Bewegung 15M / Echte Demokratie Jetzt.
Robert Misik: "Radikalismus auf der Höhe der Zeit" - Rezension von "Nach dem Kapitalismus" (22. Juni 2011)
Der österreichische Publizist Robert Misik rezensiert im Wiener Stadtmagazin "Falter" das Essaybuch "Nach dem Kapitalismus. Perspektiven der Emanzipation oder das Projekt Communismus anders denken" (VSA-Verlag). Seine Einschätzung: "Radikalismus auf der Höhe der Zeit".
Perspektiven der Emanzipation. Das Projekt Communismus anders denken. Videodokumentation der «Luxemburg Lecture» mit Raul Zelik im Gespräch mit Gregor Gysi und Wolfgang Engler

Anfang Juni 2011 luden das Literaturforum des Berthold-Brecht-Hauses in Berlin und die Rosa-Luxemburg-Stiftung Wolfgang Engler, Gregor Gysi und Sylvia Fehrmann ein, um über Raul Zeliks Essay "Nach dem Kapitalismus" zu diskutieren.
Licht und Schatten in Venezuela. Versuch einer realistischen Bilanz (Le Monde Diplomatique Mai 2011)

Auch zwölf Jahre nach dem Amtsantritt von Präsident Hugo Chávez fällt eine Bewertung der „bolivarianischen Revolution“ alles andere als leicht. Im November war im venezolanischen Staatsfernsehen ein Auftritt des Präsidenten zu sehen, der die widersprüchliche Lage gut illustriert.
Neue Entwicklungskonzepte oder alter Staatszentrismus? “Endogene Entwicklung” und der “Sozialismus des 21. Jahrhunderts” in Venezuela (wissenschaftlicher Aufsatz Sommer 2011)

Wenn von der Sozial- und Wirtschaftspolitik der Regierung Chávez die Rede ist, bringen Kritiker/innen gewöhnlich sofort zwei Argumente ins Spiel: Erstens sei es kein Kunststück, mit hohen Öleinnahmen Sozialprogramme zu finanzieren, zweitens verschärfe die Staatszentriertheit der Wirtschaftspolitik die alten Strukturprobleme Venezuelas nur weiter.
Die unerwartete Rückkehr der Räte (verdi.publik 9/2011)

In den vergangenen Wochen sind in Madrid, Barcelona, Athen und anderen südeuropäischen Städten Hunderttausende auf den Straßen gewesen. Ihre Hauptforderung – Schluss mit der EU-verordneten Umverteilungspolitik zugunsten des Finanzkapitals – ist nicht neu, und doch ist eine neue Form von Bewegung sichtbar geworden. Der 15-M, wie sie in Spanien genannt wird, geht es nämlich nicht einfach darum, Regierende zu einer anderen Politik zu bewegen oder eine andere Partei ins Amt zu bringen. Sie stellt die bürgerliche, repräsentative Demokratie als solche in Frage.
Der zerrissene Lumpensammler. Jean Michel Palmiers Buch über Walter Benjamin (Rezension WOZ April 2010)
Im Suhrkamp-Verlag ist eine vom 1998 verstorbenen Kulturwissenschaftler Jean-Michel Palmier verfasste Benjamin-Biografie erschienen. Ein Monumentalwerk, das es erlaubt, Walter Benjamin zu entmystifizieren und theoretisch einzuordnen.
Unsichtbare Grenzen. Alltag in Medellín (Literaturen 5/2011)
Medellín, die «Stadt des ewigen Frühlings», ist wegen ihres Klimas, vor allem aber für ihre Drogen-Kartelle weltberühmt: 2000 Morde im Jahr gehen auf deren Rechnung. Wie lässt sich da noch ein normales Leben führen?
Die Vermessung der Utopie. Ein Gespräch über Mythen des Kapitalismus und die kommende Gesellschaft
Gesprächsbuch - Raul Zelik & Elmar Altvater
Sachbuch | ISBN : 978-3-936738-62-9 | 208 Seiten | Oktober 2009 | 14,90 € | lieferbar | Blumenbar-Verlag
Ob Klimawandel, industrielle Überkapazitäten, Arbeitslosigkeit oder Verteilung des Reichtums – der »freie Markt« scheint grundlegende soziale und wirtschaftliche Probleme nicht lösen zu können. Doch ist eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus überhaupt noch vorstellbar? Raul Zelik und Elmar Altvater liefern in ihrem Gespräch eine radikal-kritische Analyse der Gegenwart. Ihr gemeinsamer Versuch, ein utopisches Gesellschaftsmodell zu entwickeln, geht von einem Ökonomiebegriff aus, der das ökologische und soziale Gemeinwohl einbezieht und auf Vernunft gegründet ist.
Befreit von 'Vaterlandsverrätern'. Über den vergessenen Widerstand in Kärnten (Feature Deutschlandfunk Juni 2010)
In den 1940er Jahren war Kärnten die einzige Region des damaligen Deutschen Reiches, in der es im grösseren Stil Widerstand gegen den Nationalsozialismus gab. Etwa 500 Österreicher, die meisten von ihnen Angehörige der slowenischsprachigen Minderheit, kämpften in den Tälern des Karawanken-Gebirges gegen die Wehrmacht.
Seite teilen
Design zersetzer. freie grafik / Berlin
Programmierung, Umsetzung G@HServices Berlin V.V.S.
Kopfbild Freddy Sanchez Caballero / Kolumbien











