Aktuelles
"Meine innere Sicherheit. Überfall im Görlitzer Park" (WOZ 21.11 / Tagesspiegel 9.12.2013)

Im Krankenhaus, am ersten Tag nach dem Überfall, rechne ich mit Angriffen von allen Seiten. Der neue Pfleger, der mir den Tropf anlegt, ohne sich vorzustellen, sieht verdächtig aus. Hat nicht schon einmal eine Pflegerin in der Charité mehrere Patienten zu Tode gespritzt? Als die Zimmertür ein Stück weit offen steht, greife ich nicht in den Spalt, weil ich fürchte, jemand könnte die Tür absichtlich von innen zuziehen. Nach dem Angriff auf den Körper ist das Frühwarnsystem aktiviert: Alle mir unbekannten Personen stellen eine Gefahr dar. Umwelt als Feindesland.
"Es geht nicht darum, wer die Regierung stellt: eine Stimme gegen den neoliberalen Konsens" (Zu den Wahlen am 22.9.2013)

Diese Woche jährt sich der Putsch gegen die Linksregierung in Chile zum vierzigsten Mal. Zwar hat das Chile von 1973 wenig bis gar nichts mit dem Europa der 2010er Jahre zu tun – in Europa gibt es keine starke Arbeiterbewegung, keine Welle von Landbesetzungen, kaum (wahrnehmbare) kritische Intelligenz. Aber immerhin zeigt der Putsch von ’73 doch, dass die alte Parole „Wahlen ändern nichts, sonst wären sie verboten“ so ganz nicht stimmen kann. Wenn Wahlen nie etwas verändern würden, müssten Eliten nicht versuchen, Wahlergebnisse auf die eine oder andere Weise zu korrigieren. Wenn schon, müsste der Spruch lauten: „Wenn Wahlen was zu verändern beginnen, werden sie verboten.“
"Nach Chile. 40 Jahre Putsch gegen Allende" (Veranstaltungsbeitrag Duisburg 4.9.2013)

Ich habe die Einladung, über den Putsch in Chile zu sprechen, gern angenommen, obwohl es weitaus kompetentere Referenten geben würde: unter chilenischen Exilanten sowieso, aber auch unter deutschen Linken: Klaus Meschkat zum Beispiel, der in den 1960er Jahren führender SDS-Aktivist war, 1969 nach Kolumbien ging, ab 1971 unter der Allende-Regierung über die Selbstorganisierung von chilenischen Arbeitern forschte und nach dem Putsch schließlich im Lager von Quiriquina inhaftiert war.
Wenn ich hier trotzdem reden möchte, dann weil ich mich involviert fühle. Meine Biografie ist mit dem Putsch auf seltsame Weise verwoben. Man könnte sagen: Ohne Pinochet gäbe es meine Kinder nicht.
"Von Konstellationen und Hegemonie - Linksregierungen versus Emanzipation?" (Aufsatz aus "Andere mögliche Welten", VSA: Verlag)
 In den 1980er Jahren sprachen deutsche Medien über die bundesrepublikanische Politik ganz ähnlich wie in den 2000er Jahren über Lateinamerika. Sie unterschieden zwischen einer ‚realistischen Linken‘, die mit umsetzbaren Projekten eine wirkliche Veränderung der Gesellschaft voranbringen wollte, und einer ‚Fundi-Linken‘, die angeblich Opfer ihrer ideologischen Postulate war und nur Hass und Illusionen schürte. Dieser Diskurs begleitete v.a. die Entwicklung der Grünen, die gerade als politisches Sprachrohr der außerparlamentarischen Bewegungen entstanden und in zwei Lager zerfallen waren. Den Realos, angeführt von Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit, ging es in erster Linie um das Zustandekommen einer Koalitionsregierung mit den Sozialdemokraten, was sich in dem unablässigen Bemühen ausdrückte, „Politikfähigkeit“ unter Beweis zu stellen. Die vermeintlichen ‚Fundamentalisten‘ hingegen bestanden darauf, dass Regierungswechsel nicht zwangsläufig emanzipatorische Veränderungen nach sich ziehen, und setzten daher auf die Stärkung außerparlamentarischer sozialer Bewegungen.
In den 1980er Jahren sprachen deutsche Medien über die bundesrepublikanische Politik ganz ähnlich wie in den 2000er Jahren über Lateinamerika. Sie unterschieden zwischen einer ‚realistischen Linken‘, die mit umsetzbaren Projekten eine wirkliche Veränderung der Gesellschaft voranbringen wollte, und einer ‚Fundi-Linken‘, die angeblich Opfer ihrer ideologischen Postulate war und nur Hass und Illusionen schürte. Dieser Diskurs begleitete v.a. die Entwicklung der Grünen, die gerade als politisches Sprachrohr der außerparlamentarischen Bewegungen entstanden und in zwei Lager zerfallen waren. Den Realos, angeführt von Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit, ging es in erster Linie um das Zustandekommen einer Koalitionsregierung mit den Sozialdemokraten, was sich in dem unablässigen Bemühen ausdrückte, „Politikfähigkeit“ unter Beweis zu stellen. Die vermeintlichen ‚Fundamentalisten‘ hingegen bestanden darauf, dass Regierungswechsel nicht zwangsläufig emanzipatorische Veränderungen nach sich ziehen, und setzten daher auf die Stärkung außerparlamentarischer sozialer Bewegungen.
"Anatomía de la literatura anfibia" (artículo en N, suplemento del periódico argentino CLARÍN, junio 2013)

De Fernando de Leonardis
Es posible que un registro ficcional se concrete en el plano de lo real? La mímesis explicaría, quizá, la transformación contenida en la pregunta. De acuerdo a Aristóteles, el término permite aludir a las relaciones entre literatura y realidad. La mímesis enlaza hechos: da inteligibilidad a ciertos sucesos y dota de sentido a la acción humana, produciendo efectos fuera de la ficción. Pensemos en Palestina entre 1898 y 1948. ¿La fantasía que derrama el Antiguo Testamento en torno a la “tierra prometida” no fue el combustible espiritual de la colonización del territorio palestino y posterior establecimiento del Estado sionista? Los textos ficcionales crean mundos posibles, y si la militancia se desarrolla en condiciones de realidad adecuadas, el activismo hará que la ficción se convierta en lo real.
"Hola a Berlín" (Resena de "Situaciones Berlinesas" en Página 12 / Argentina")
Raul Zelik es uno de los escritores alemanes contemporáneos que mejor saben combinar la comedia de la vida de su país con el humor y una mirada que puede llegar a ser sumamente crítica. Y como si fuera poco, el autor de Situaciones berlinesas es un experto en historia latinoamericana.
Mario, de 32 años transcurridos bastante en vano, comparte con otros hombres tan perdidos como él un departamento en el barrio turco de Berlín, cuya cocina se ve invadida un día por unos ruidosos rumanos. A fin de sacárselos de encima, y de paso ganarse unos euros, los miembros de esta muy alemana unidad cuasi familiar montan una agencia ad hoc de cobro de deudas entre constructoras que emplean a ilegales (como los rumanos).
"Me gustaría ser un ex comunista ex yugoslavo" (entrevista con el periódico argentino Página 12, mayo 2013)

Por Silvina Friera
El escritor vino a la Argentina a presentar Situaciones berlinesas, una comedia desopilante y feroz sobre la barbarie que padecen los inmigrantes en Alemania. Su posición política es radical: propone por ejemplo la “expropiación de los grandes consorcios mediáticos”.
La risa es siempre un buen principio. Cuando la carcajada de los lectores estalla en las primeras líneas de una novela, resulta casi imposible abandonar las páginas, excepto que se produzca una hecatombe narrativa, un brusco cambio de tono, inconsistencias soporíferas y otros gajes del oficio.
"Am Beispiel Navarra. Soziale Krise und Nationalitätenkonflikt im spanischen Staat" (Le Monde Diplomatique April 2013)
 Seit im Mai 2011 in Madrid die Protestbewegung 15M entstand, ist Spanien nicht mehr zur Ruhe gekommen. Zwar ist die 15M weitgehend zerfallen, doch die Sozialproteste halten unvermindert an: Fast wöchentlich kommt es zu Demonstrationen gegen die Kürzungspolitik der Regierung, die Umfragewerte der Volksparteien PP und PSOE befinden sich im freien Fall [1], und überall im Land sind neue Basisinitiativen entstanden – wie etwa die Bewegung gegen Zwangsräumungen „Stop Desahucios“. Die Krise Spaniens hat jedoch nicht nur mit dem Finanz-Crash zu tun. Das gesamte, in der Transición, d.h. der Demokratisierung nach Francos Tod 1975 ausgehandelte politische Modell steht heute zur Disposition. Soziale, republikanische und Demokratisierungsanliegen verbinden sich dabei – zum Teil auf widersprüchliche Weise – mit den Nationalitätenkonflikten im spanischen Staat.
Seit im Mai 2011 in Madrid die Protestbewegung 15M entstand, ist Spanien nicht mehr zur Ruhe gekommen. Zwar ist die 15M weitgehend zerfallen, doch die Sozialproteste halten unvermindert an: Fast wöchentlich kommt es zu Demonstrationen gegen die Kürzungspolitik der Regierung, die Umfragewerte der Volksparteien PP und PSOE befinden sich im freien Fall [1], und überall im Land sind neue Basisinitiativen entstanden – wie etwa die Bewegung gegen Zwangsräumungen „Stop Desahucios“. Die Krise Spaniens hat jedoch nicht nur mit dem Finanz-Crash zu tun. Das gesamte, in der Transición, d.h. der Demokratisierung nach Francos Tod 1975 ausgehandelte politische Modell steht heute zur Disposition. Soziale, republikanische und Demokratisierungsanliegen verbinden sich dabei – zum Teil auf widersprüchliche Weise – mit den Nationalitätenkonflikten im spanischen Staat.
"Demokratie und Polarisierung." (Venezuela-Kommentar TAZ 23.4.2013)
 Nach den anhaltenden Protesten der bürgerlichen Opposition zweifelt die Weltöffentlichkeit – allen voran Washington und die internationalen Leitmedien CNN und EL PAIS – mal wieder am Zustand der venezolanischen Demokratie. Zwar sind die Falschmeldungen der letzten Tage mittlerweile widerlegt: Die Toten stammen nicht etwa aus Oppositionsreihen, sondern sind Regierungsanhänger, die bei Angriffen von Oppositionellen auf staatliche Gesundheitsposten und andere öffentliche Einrichtungen getötet wurden. Und auch die These der Wahlfälschung scheint vom Tisch. Nachdem 54% der Urnen – wie im venezolanischen Wahlsystem üblich – sofort nach Zufallsprinzip gegengezählt worden waren, werden nun auch noch die fehlenden 46% manuell überprüft.
Nach den anhaltenden Protesten der bürgerlichen Opposition zweifelt die Weltöffentlichkeit – allen voran Washington und die internationalen Leitmedien CNN und EL PAIS – mal wieder am Zustand der venezolanischen Demokratie. Zwar sind die Falschmeldungen der letzten Tage mittlerweile widerlegt: Die Toten stammen nicht etwa aus Oppositionsreihen, sondern sind Regierungsanhänger, die bei Angriffen von Oppositionellen auf staatliche Gesundheitsposten und andere öffentliche Einrichtungen getötet wurden. Und auch die These der Wahlfälschung scheint vom Tisch. Nachdem 54% der Urnen – wie im venezolanischen Wahlsystem üblich – sofort nach Zufallsprinzip gegengezählt worden waren, werden nun auch noch die fehlenden 46% manuell überprüft.
"Situaciones berlinesas" - argentinische Ausgabe // edición argentina

Zur Buchmesse in Buenos Aires erscheint der Roman "Berliner Verhältnisse" im Verlag Cruce in einer argentinischen Edition. Die Übersetzung von Florencia Martín wurde neu durchgesehen und an den argentinischen Sprachraum angepasst.
Para la Feria del Libro en Buenos Aires, mi novela "Situaciones Berlinesas es re-editada por la Casa Editorial Cruce. La traducción de Florencia Martín ha sido revisada y adaptada al espacio de habla argentina.
"El chavismo ha representado una ruptura fundamental" (Entrevista con el Diario La Nación / Buenos Aires 12.4.2013)
 Además de escribir ficción, el autor alemán Raul Zelik es un reconocido analista de la vida política venezolana desde el arribo al poder de Hugo Chávez. Días antes de llegar a Buenos Aires para participar en la Feria del Libro, habla de sus novelas más recientes y del futuro que aguarda a Venezuela después de las elecciones del domingo.
Además de escribir ficción, el autor alemán Raul Zelik es un reconocido analista de la vida política venezolana desde el arribo al poder de Hugo Chávez. Días antes de llegar a Buenos Aires para participar en la Feria del Libro, habla de sus novelas más recientes y del futuro que aguarda a Venezuela después de las elecciones del domingo.
Decir, como se ha dicho otras veces, que el alemán Raul Zelik habita en las fronteras no es una simple metáfora para referirse a quien domina tanto la ficción como la crónica, la novela (basta pensar en Situaciones berlinesas o en la reciente Der Eindringling -"El intruso"-, todavía inédita en castellano) como la imperiosa intervención política. Ya desde la década de 1980, antes de cumplir veinte años, Zelik empezó a interesarse por América Latina, a visitar la región, a estudiar ciencias políticas y a conocer su historia desde una perspectiva crítica. El primer foco fue Colombia, y luego, hasta ahora, Venezuela, sobre todo a partir del ascenso de Hugo Chávez al poder.
"Vermittlungsversuch" (Rezension Dieter Boris, Junge Welt 11.3.2013)

Im Februar 2013 ist unser Sammelband "Andere mögliche Welten. Krise, Linksregierungen, populare Bewegungen. Eine lateinamerikanisch-europäische Debatte" im VSA: Verlag erschienen. Dieter Boris, exzellenter Lateinamerika-Kenner und marxistischer Soziologe, hat sich die Mühe gemacht, das Buch aufmerksam zu lesen und eingehend zu kritisieren.
Das Buch versammelt Beiträge von Klaus Meschkat, Patricia Chávez (Bolivien), Elmar Altvater, Andrés Antillano (Venezuela), Pablo Ospina (Ecuador), Leopoldo Múnera (Kolumbien), Joachim Hirsch und Jairo Estrada (Kolumbien). Wer Amazon nicht schätzt, kann das Buch auch hier bestellen.
"Die Leerstelle Vater" Rezension von Detlef Grumbach (Deutschlandfunk)

Die Rezension (und Gespräch) von Detlef Grumbach im DLF.
Venezuela nach Chávez

Regierungskontinuität, Rechtsruck, Bürgerkrieg oder populare Demokratisierung - nach Chávez' Tod sind zunächt alle Szenarien in Venezuela denkbar.
Ein aktualisierter Text über die mögliche Zukunft des Chavismus als lateinamerikanisch-soziales Reformprojekt.
"Andere mögliche Welten. Krise, Linksregierungen, populare Bewegungen - eine europäisch-lateinamerikanische Debatte" von A. Tauss & R. Zelik
 Die Krise ist vielschichtig und allgegenwärtig. Doch Debatten über gesellschaftliche Alternativen werden kaum geführt. In "Andere mögliche Welten" haben wir den Versuch unternommen, konkreter über antikapitalistische Perspektiven zu diskutieren. In diesem europäisch-lateinamerikanischen Projekt, an dem sich AktivistInnen und SozialwissenschaftlerInnern aus sechs Ländern beteiligt haben, geht um die Aktualität der Rätedemokratie, das Spannungsfeld zwischen popularen Bewegungen und Linksregierungen in Lateinamerika, die Erfahrungen der freien Software-Bewegung, die Krise des fossilistischen Energiemodells sowie um konkrete Transformationsstrategien.
Die Krise ist vielschichtig und allgegenwärtig. Doch Debatten über gesellschaftliche Alternativen werden kaum geführt. In "Andere mögliche Welten" haben wir den Versuch unternommen, konkreter über antikapitalistische Perspektiven zu diskutieren. In diesem europäisch-lateinamerikanischen Projekt, an dem sich AktivistInnen und SozialwissenschaftlerInnern aus sechs Ländern beteiligt haben, geht um die Aktualität der Rätedemokratie, das Spannungsfeld zwischen popularen Bewegungen und Linksregierungen in Lateinamerika, die Erfahrungen der freien Software-Bewegung, die Krise des fossilistischen Energiemodells sowie um konkrete Transformationsstrategien.
"Die Fabrik des verschuldeten Menschen" von M. Lazzarato (Rezension WOZ // 10. Januar 2013)

Als die Finanzkrise im Herbst 2008 die Welt erschütterte, schien das Ende des Neoliberalismus eingeläutet. Selbst auf den Wirtschaftsseiten der großen bürgerlichen Zeitungen rief man nach politischer Kontrolle der Finanzmärkte, und so mancher Kommentator sah eine neue keynesianische Ära heraufziehen. Heute, keine fünf Jahre später, reiben wir uns verwundert die Augen: Der Neoliberalismus ist lebendiger denn je. Die private Aneignung öffentlichen Reichtums hat sich im Rahmen der Bankenrettung beschleunigt. Nicht die Macht der Politik über die Finanzmärkte, sondern umgekehrt die der Finanzmärkte über die Politik ist ausgebaut worden. Anstelle eines Green New Deal beherrschen Spar- und Anpassungsprogramme das Bild.
"Land grabbing" (Rezension WDR 3 - 11. Januar 2013)
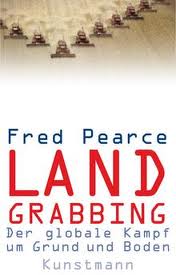
Anmoderation
Im vergangenen Jahrzehnt sind weltweit riesige Flächen Natur- und Ackerland von Großunternehmen und Finanzinvestoren aufgekauft worden. Bodenspekulation und die steigende Nachfrage nach Agrarprodukten verwandeln Land in ein zunehmend wertvolles Gut. Doch wer profitiert von diesem Prozess und wie geht er konkret vonstatten? Der britische Wissenschaftsjournalist Fred Pearce ist in Land Grabbing. Der globale Kampf um Grund und Boden diesen und anderen Fragen nachgegangen.
"Zelik fragt nach den Mühen der Ebene" (Rezension Berliner Zeitung / Frankfurter Rundschau, 18.12.2012)
 Raul Zelik erzählt in seinem neuen Roman „Der Eindringling“ ohne zu große Rührseligkeit von einem Vater-Sohn-Konflikt der anderen Art. Daniel ist jung und langweilig. Sein Vater Fil verließ die Familie, um sich seinem Dasein als radikaler Politaktivist zu widmen. Als Fil krank wird, muss Daniel sich ihm zwangsläufig annähern.
Raul Zelik erzählt in seinem neuen Roman „Der Eindringling“ ohne zu große Rührseligkeit von einem Vater-Sohn-Konflikt der anderen Art. Daniel ist jung und langweilig. Sein Vater Fil verließ die Familie, um sich seinem Dasein als radikaler Politaktivist zu widmen. Als Fil krank wird, muss Daniel sich ihm zwangsläufig annähern.
"Keine Lichter am Weihnachtsbaum" (Interview über Ungleichheit in Deutschland, 24.12.2012)
 Trotz aller Beschwichtigungen, die nach der Veröffentlichung des Armutsberichts in großen Zeitungen zu lesen waren, lassen die statistischen Daten keinen Zweifel: Die soziale Ungleichheit ist seit den 1990er Jahren in Deutschland und global stark gewachsen.
Trotz aller Beschwichtigungen, die nach der Veröffentlichung des Armutsberichts in großen Zeitungen zu lesen waren, lassen die statistischen Daten keinen Zweifel: Die soziale Ungleichheit ist seit den 1990er Jahren in Deutschland und global stark gewachsen.
Aber womit hat dieser Prozess eigentlich zu tun und wie wäre er zu stoppen? Die SWR-Journalistin Doris Maull und Raul Zelik im Gespräch.
Sozialökologische Transformationen und / oder ...? (Vortrag auf der Konferenz "Plan B" vom 27.10.2012)
 Vor dem Hintergrund von Klimawandel und Finanzkrise scheint vielen klar, dass es grundlegender Veränderungen bedarf. Doch wie könnten ökologische, soziale und demokratische Transformationen aussehen? Und wie kann gesellschaftlicher Druck aufgebaut werden, um solche Veränderungen auch politisch durchzusetzen?
Vor dem Hintergrund von Klimawandel und Finanzkrise scheint vielen klar, dass es grundlegender Veränderungen bedarf. Doch wie könnten ökologische, soziale und demokratische Transformationen aussehen? Und wie kann gesellschaftlicher Druck aufgebaut werden, um solche Veränderungen auch politisch durchzusetzen?
Um das zu debattieren, trafen sich AktivistInnen aus sozialen Bewegungen, Gemeinderäte und Abgeordnete der LINKEN am 26. und 27. Oktober zur Konferenz PLAN B (hier gehts zum offenen Debattenforum) in Berlin.
Sozialdemokratie unter radikalen Vorzeichen? – Südamerikas „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ (Essay Le Monde Diplomatique Oktober 2012)
 Der Staatsozialismus des 20. Jahrhunderts hat den Begriff ‚Alternative‘ gründlich diskreditiert.[1] In Sachen Demokratie, Umweltschutz und Selbstbestimmung stellte er keinen erkennbaren Fortschritt dar. In Venezuela, Bolivien und Ecuador jedoch reden Linksregierungen heute wieder davon, den Kapitalismus überwinden zu wollen. Der „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ soll eine Revolution ermöglichen, die sich in Wahlen demokratisch immer wieder neu legitimiert. Mit „endogener Entwicklung“ und dem indigenen Konzept des „guten Lebens“ (sumak kawsay)[2] will man sich kapitalistischen Wachstums- und Konsumvorstellungen entziehen. Und auf den Kollaps der zentralstaatlichen Planung antwortet man mit der – sicher nicht neuen, aber auch nicht ganz falschen – Verbindung von staatlicher Intervention, dezentralen Märkten und Genossenschaftswesen.
Der Staatsozialismus des 20. Jahrhunderts hat den Begriff ‚Alternative‘ gründlich diskreditiert.[1] In Sachen Demokratie, Umweltschutz und Selbstbestimmung stellte er keinen erkennbaren Fortschritt dar. In Venezuela, Bolivien und Ecuador jedoch reden Linksregierungen heute wieder davon, den Kapitalismus überwinden zu wollen. Der „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ soll eine Revolution ermöglichen, die sich in Wahlen demokratisch immer wieder neu legitimiert. Mit „endogener Entwicklung“ und dem indigenen Konzept des „guten Lebens“ (sumak kawsay)[2] will man sich kapitalistischen Wachstums- und Konsumvorstellungen entziehen. Und auf den Kollaps der zentralstaatlichen Planung antwortet man mit der – sicher nicht neuen, aber auch nicht ganz falschen – Verbindung von staatlicher Intervention, dezentralen Märkten und Genossenschaftswesen.
So weit, so gut. Doch was wird von diesen Versprechen in der Praxis auch tatsächlich eingelöst?
"Die Leichtigkeit des Regierens" - Die linke Unabhängigkeitsbewegung in den baskischen Lokalregierungen (WOZ 18.10.2012)
 Die Krise in Spanien weitet sich allmählich zu einer politischen Staatskrise aus. Zu schaffen macht Madrid nicht nur eine Arbeitslosigkeit von 25%, sondern auch das Erstarken der Unabhängigkeitsbewegungen in den Regionen. Nachdem am katalanischen Nationalfeiertag am 11. September mehr als eine Millionen Menschen für eine Abspaltung von Spanien demonstrierten, hat die konservative Regierungspartei CiU Neuwahlen angesetzt und ein Referendum über das Selbstbestimmungsrecht Kataloniens angekündigt.
Die Krise in Spanien weitet sich allmählich zu einer politischen Staatskrise aus. Zu schaffen macht Madrid nicht nur eine Arbeitslosigkeit von 25%, sondern auch das Erstarken der Unabhängigkeitsbewegungen in den Regionen. Nachdem am katalanischen Nationalfeiertag am 11. September mehr als eine Millionen Menschen für eine Abspaltung von Spanien demonstrierten, hat die konservative Regierungspartei CiU Neuwahlen angesetzt und ein Referendum über das Selbstbestimmungsrecht Kataloniens angekündigt.
Auch das Baskenland setzt sich zunehmend von Madrid ab. Nach dem Ende der ETA haben die spanischen Parteien PSOE und PP in der Region dramatisch an Bedeutung verloren. Bei den Regionalwahlen am Sonntag kamen die beiden großen spanischen Parteien zusammen nur noch auf 31%. Gewinnerin der Wahlen war die christdemokratische Baskische Nationalistische Partei mit 34% der Stimmen; die linkssozialistische Unabhängigkeitspartei Bildu blieb mit 25% etwas hinter den Erwartungen zurück, aber ist dennoch die einzige Partei, die klar zulegen konnte.
Eine Reportage über die Erfahrungen der linken Unabhängigkeitsbewegung in den Lokal- und Provinzregierungen.
Chávez ein „Stabilitätsfaktor in Lateinamerika“?
 Trotz Krebserkrankung und der offensichtlichen Ermüdungserscheinungen seiner „bolivarischen Revolution“ hat der venezolanische Präsident Hugo Chávez gute Aussichten, aus den Wahlen am 7. Oktober erneut als Sieger hervorzugehen. Bei den meisten Umfragen liegt der Staatschef in Führung. Zu eindeutig repräsentiert der Kandidat der Rechten, Ex-Bürgermeister Henrique Capriles Radonski, die traditionellen Eliten, die auch nach 13 Jahren Linksregierung über unglaublichen Reichtum verfügen. Capriles, der von brasilianischen Wahlkampfexperten beraten wird, bemüht sich zwar um eine sozialdemokratische Rhetorik und verspricht, an den bestehenden Sozialprogrammen festzuhalten. Trotzdem ist absehbar, was ein Sieg der Opposition für Veränderungen nach sich ziehen würde.
Trotz Krebserkrankung und der offensichtlichen Ermüdungserscheinungen seiner „bolivarischen Revolution“ hat der venezolanische Präsident Hugo Chávez gute Aussichten, aus den Wahlen am 7. Oktober erneut als Sieger hervorzugehen. Bei den meisten Umfragen liegt der Staatschef in Führung. Zu eindeutig repräsentiert der Kandidat der Rechten, Ex-Bürgermeister Henrique Capriles Radonski, die traditionellen Eliten, die auch nach 13 Jahren Linksregierung über unglaublichen Reichtum verfügen. Capriles, der von brasilianischen Wahlkampfexperten beraten wird, bemüht sich zwar um eine sozialdemokratische Rhetorik und verspricht, an den bestehenden Sozialprogrammen festzuhalten. Trotzdem ist absehbar, was ein Sieg der Opposition für Veränderungen nach sich ziehen würde.
Was will Präsident Santos? Zu den Friedensverhandlungen in Kolumbien (WOZ, September 2012)

Obwohl angeblich 77% der KolumbianerInnen die Aufnahme der Friedensverhandlungen zwischen der Santos-Regierung und der FARC-Guerilla begrüßen, lässt sich nicht gerade behaupten, dass die Nachricht vergangene Woche Begeisterungsstürme ausgelöst hätte.
Zum Eintritt in die LINKE. Eine Antwort auf Ingo Stützle und den AK
 Unter der Überschrift Kommse rein, könnse rausgucken hat die Zeitung „analyse & kritik“ den Eintritt von einem Dutzend Linken in die LINKE kritisiert. „Bisher ist unklar“, fand die Redaktion, „was diese Kampagne so kurz nach dem Parteitag sollte.“ Davor hatte bereits Ingo Stützle, der auch u.a. für den AK schreibt, meinem Eintritt nichts Gutes abgewinnen können. Hier mein Versuch, auf einige ihrer Einwände zu antworten.
Unter der Überschrift Kommse rein, könnse rausgucken hat die Zeitung „analyse & kritik“ den Eintritt von einem Dutzend Linken in die LINKE kritisiert. „Bisher ist unklar“, fand die Redaktion, „was diese Kampagne so kurz nach dem Parteitag sollte.“ Davor hatte bereits Ingo Stützle, der auch u.a. für den AK schreibt, meinem Eintritt nichts Gutes abgewinnen können. Hier mein Versuch, auf einige ihrer Einwände zu antworten.
Rätedemokratie // Liquid Democracy // Krise der Repräsentation (Beitrag TAZ 17.7.2012)
 Ein Gespenst geht um, nicht nur in Europa – die ‚Krise der Repräsentation‘. In Lateinamerika sind im vergangenen Jahrzehnt in mehreren Ländern die Parteienysteme vollständig kollabiert. In den USA steht die institutionelle Politik von links (Occupy) und rechts (Tea Party) unter Druck. In Finnland, Dänemark und den Niederlanden artikulieren heute rassistisch-populistische Parteien die Unzufriedenheit mit der real existierenden Demokratie, in Spanien hat die Frustration mit dem Parlamentarismus zum Entstehen einer breiten sozialen Bewegung geführt. Und in Deutschland schließlich, wo man es immer gern etwas geordneter hat, gibt es immerhin die PIRATEN, die zwar angepasster sind, als sie selbst meinen, aber trotzdem eine Antwort auf die Sinnentleerung der politischen Verhältnisse darstellen.
Ein Gespenst geht um, nicht nur in Europa – die ‚Krise der Repräsentation‘. In Lateinamerika sind im vergangenen Jahrzehnt in mehreren Ländern die Parteienysteme vollständig kollabiert. In den USA steht die institutionelle Politik von links (Occupy) und rechts (Tea Party) unter Druck. In Finnland, Dänemark und den Niederlanden artikulieren heute rassistisch-populistische Parteien die Unzufriedenheit mit der real existierenden Demokratie, in Spanien hat die Frustration mit dem Parlamentarismus zum Entstehen einer breiten sozialen Bewegung geführt. Und in Deutschland schließlich, wo man es immer gern etwas geordneter hat, gibt es immerhin die PIRATEN, die zwar angepasster sind, als sie selbst meinen, aber trotzdem eine Antwort auf die Sinnentleerung der politischen Verhältnisse darstellen.
Grüner Sozialismus und ‚gutes Leben’. (Beitrag für LuXemburg Herbst 2012)
 In den Industriegesellschafen hat sich in den letzten Jahren das Bewusstsein durchgesetzt, dass das herrschende Energie-, Konsum- und Produktionsmodell grundlegend transformiert werden muss. Eine ökologische Wende scheint konsensfähig, wenn auch nicht ausgemacht. Im Mainstream-Diskurs wird dieser Politikwechsel v.a. unter den Stichworten „Green Economy“ und „Green New Deal“ verhandelt. Der grundlegende Widerspruch bleibt bei dieser Debatte jedoch ausgeblendet: Kapitalakkumulation braucht Wachstum. Wo weniger produziert und konsumiert wird, wird aber auch weniger in Wert gesetzt. Der Kapitalismus verträgt sich faktisch nicht mit De-Growth-Strategien.
In den Industriegesellschafen hat sich in den letzten Jahren das Bewusstsein durchgesetzt, dass das herrschende Energie-, Konsum- und Produktionsmodell grundlegend transformiert werden muss. Eine ökologische Wende scheint konsensfähig, wenn auch nicht ausgemacht. Im Mainstream-Diskurs wird dieser Politikwechsel v.a. unter den Stichworten „Green Economy“ und „Green New Deal“ verhandelt. Der grundlegende Widerspruch bleibt bei dieser Debatte jedoch ausgeblendet: Kapitalakkumulation braucht Wachstum. Wo weniger produziert und konsumiert wird, wird aber auch weniger in Wert gesetzt. Der Kapitalismus verträgt sich faktisch nicht mit De-Growth-Strategien.
"Kolumbien: Bewaffneter Konflikt und indigene Autonomie" - RLS Standpunkte International 8/2012
 Mitte Juli setzte die Indígena-Bewegung den Krieg in Kolumbien wieder auf die politische Agenda. Unbewaffnet und nur mit Einsatz ihrer Körper vertrieben mehrere Hundert Angehörige der Gemeinschaft der Nasa kolumbianische SoldatInnen von einem Armeestützpunkt in einem Indígena-Gebiet im Departement Cauca. Die Regierung Santos reagierte entgegen aller liberalen Rhetorik mit offener Gewalt und entsandte zusätzliche Contra-Guerilla-Verbände in die Region. Bei den darauf folgenden Protesten wurden zwei Indigene von Militärs getötet, Dutzende weitere verletzt. Auch die angeblich demobilisierten Paramilitärs meldeten sich wieder zu Wort. Unmittelbar nach den Protesten erhielt der Sprecher des regionalen Indígena-Verbands ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) Feliciano Valencia eine Morddrohung von einer paramilitärischen Gruppe.
Mitte Juli setzte die Indígena-Bewegung den Krieg in Kolumbien wieder auf die politische Agenda. Unbewaffnet und nur mit Einsatz ihrer Körper vertrieben mehrere Hundert Angehörige der Gemeinschaft der Nasa kolumbianische SoldatInnen von einem Armeestützpunkt in einem Indígena-Gebiet im Departement Cauca. Die Regierung Santos reagierte entgegen aller liberalen Rhetorik mit offener Gewalt und entsandte zusätzliche Contra-Guerilla-Verbände in die Region. Bei den darauf folgenden Protesten wurden zwei Indigene von Militärs getötet, Dutzende weitere verletzt. Auch die angeblich demobilisierten Paramilitärs meldeten sich wieder zu Wort. Unmittelbar nach den Protesten erhielt der Sprecher des regionalen Indígena-Verbands ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) Feliciano Valencia eine Morddrohung von einer paramilitärischen Gruppe.
Bolivien: Auf dem Weg zum „Anden-Kapitalismus“? - Reportage WOZ 24.5.2012
 In Bolivien ist man an Straßenproteste gewöhnt. Es gehört zur politischen Kultur, dass gesellschaftliche Gruppen ihre Anliegen zunächst durch Blockaden kundtun. Doch in diesen Wochen kann man in La Paz den Überblick verlieren. Seitdem die Regierung Morales die Arbeitszeit in den Krankenhäusern von 6 auf 8 Stunden täglich verlängern will, befindet sich die bürgerliche Ärztekammer im Ausstand. Der trotzkistisch beeinflusste Gewerkschaftsdachverband COB hat zum Generalstreik gegen die vom Präsidenten dekretierten acht Prozent Lohnerhöhung aufgerufen, und auf dem Prado, der Flanierstraße der bolivianischen Hauptstadt, campieren seit Wochen die Angehörigen der Verschwundenen, um eine Aufklärung der während der Diktatur begangenen Menschenrechtsverbrechen zu erreichen. Bislang hat die Regierung Morales, um ihr Bündnis mit der Armee nicht zu gefährden, die Militärs vor Untersuchungen geschützt.
In Bolivien ist man an Straßenproteste gewöhnt. Es gehört zur politischen Kultur, dass gesellschaftliche Gruppen ihre Anliegen zunächst durch Blockaden kundtun. Doch in diesen Wochen kann man in La Paz den Überblick verlieren. Seitdem die Regierung Morales die Arbeitszeit in den Krankenhäusern von 6 auf 8 Stunden täglich verlängern will, befindet sich die bürgerliche Ärztekammer im Ausstand. Der trotzkistisch beeinflusste Gewerkschaftsdachverband COB hat zum Generalstreik gegen die vom Präsidenten dekretierten acht Prozent Lohnerhöhung aufgerufen, und auf dem Prado, der Flanierstraße der bolivianischen Hauptstadt, campieren seit Wochen die Angehörigen der Verschwundenen, um eine Aufklärung der während der Diktatur begangenen Menschenrechtsverbrechen zu erreichen. Bislang hat die Regierung Morales, um ihr Bündnis mit der Armee nicht zu gefährden, die Militärs vor Untersuchungen geschützt.
¿Revoluciones Facebook? - Sobre el nuevo fetichismo tecnológico (Revista HUMBOLDT, Nr.157 - Protesta 2.0)

Traducción del alemán: Ricardo Bada
Los medios electrónicos son sobrevalorados muchas veces, pero encierran potenciales contradictorios. Una revisión en base al ejemplo Colombia.
Es un lugar común: los medios electrónicos y las redes sociales cambian la política y los movimientos sociales. Tuitear se ha convertido en una amplia forma de comunicación; con los “Piratas” (véase el artículo de Probst en este número), han nacido en numerosos países europeos unos partidos que quieren ampliar las nuevas posibilidades de la comunicación electrónica para convertirlas en programa social, y a las sublevaciones de la “primavera árabe” se las llega a considerar “revoluciones Facebook”.
Seite teilen
Design zersetzer. freie grafik / Berlin
Programmierung, Umsetzung G@HServices Berlin V.V.S.
Kopfbild Freddy Sanchez Caballero / Kolumbien
